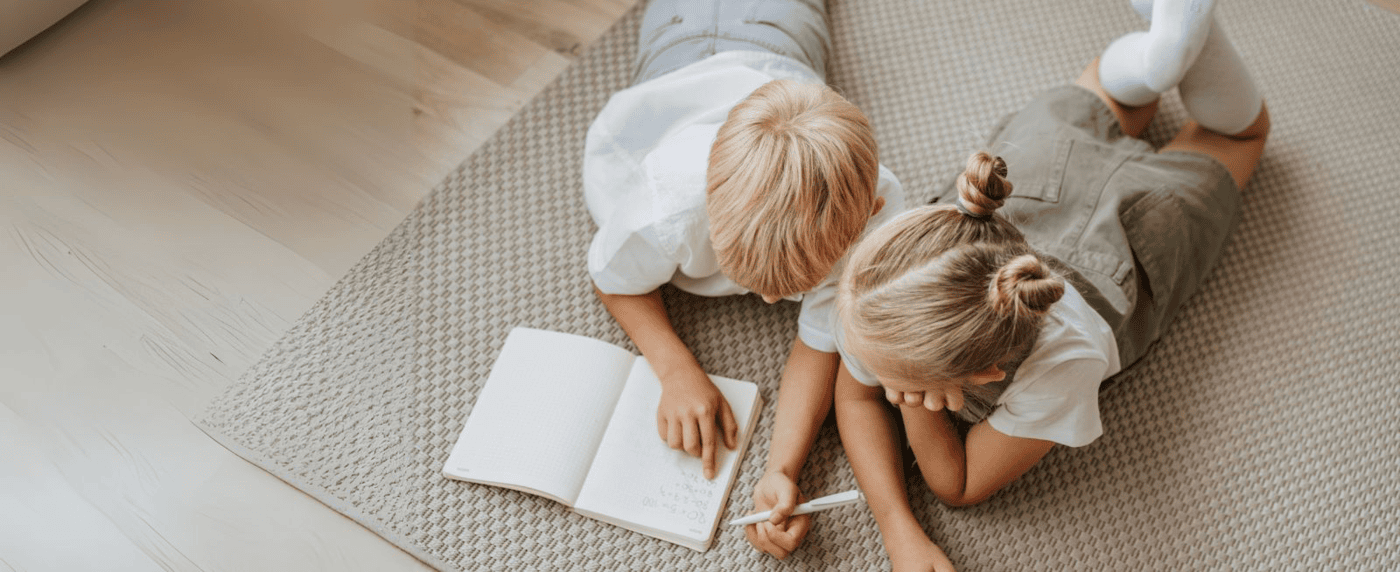Kinder trauern anders
Auch Tote essen Nutella. Nur nicht ganz so viel. Marion Neumann erlebt jeden Tag, dass Kinder ganz eigene Vorstellungen von Tod und Sterben haben. Nicht nur in ihrer Arbeit mit Kindern im Kinder- und Jugendhospiz in Tambach-Dietharz, die selbst lebensverkürzend erkrankt sind, auch in der Trauerbegleitung für solche, die einen nahestehenden Menschen verloren haben, geht es immer wieder um die Auseinandersetzung mit dem Tod, mit Sterben, Abschied, Trauer und den vielen Fragen dazwischen.
Am 13. Mai fasste Marion Neumann bei einem von Philip Julius e. V. organisierten Online-Info-Abend zum Thema „Wie Kinder trauern“ ihre zentralen Erfahrungen aus der Trauerbegleitung zusammen, öffnete den Blick für kindliche Perspektiven auf den Tod und gab konkrete Tipps zum Umgang mit trauernden Kindern und Jugendlichen. Wie auch in ihrer praktischen Arbeit nutzte sie dazu die Impulse thematisch einschlägiger Kinderbücher, darunter „Tote essen auch Nutella“ (Martina Plieth), „Leni und die Trauerpfützen“ (Hannah-Marie Heine), „Was mach ich nur mit meiner Trauer?“ (Dagmar Geisler), „Sehen wir uns morgen?“ (Alice Kuipers) und „Weil du mir so fehlst“ (Andreas Klammt/Ayse Bosse).
Wie Kinder sich den Tod vorstellen
Zunächst ging Neumann darauf ein, wie Kinder, abhängig von ihrem Alter und ihrer jeweiligen Entwicklungsphase, aber auch ihrem Umfeld und dem, was sie dort wahrnehmen, sich den Tod vorstellen. „Wenn du nicht tot sein willst, dann hörst du einfach damit auf und dann fängt alles wieder von vorne an“, zitierte sie ein Kind. Ein anderes fragte: „Wer kocht mir dann Kakao, wenn alle tot sind?“
Bis zum Alter von etwa zwei Jahren steht im Trauererleben eines Kindes der Verlust im Vordergrund. Plötzlich fehlt eine Bezugsperson, jemand, der dem Kind vielleicht Wärme und Zärtlichkeit geschenkt hat. Hier gelte es, das, was als fehlend empfunden wird, etwa die Nähe und Geborgenheit, zurückzugeben. Zudem nimmt das Kleinkind auch negative Reize aus dem nahen Umfeld, etwa die Trauer der Erwachsenen, Angst oder Angespanntheit wahr und kann darauf beispielsweise mit Verunsicherung, Weinen oder Unruhe reagieren.
Bei Kindern im Vorschulalter ist grundsätzlich das Interesse an der Umwelt stärker ausgeprägt, sie beobachten, nehmen Veränderungen wahr, unterscheiden zwischen „tot“ und „lebendig“. Dabei können sie in der Regel jedoch die Endgültigkeit des Todes noch nicht erfassen und gehen davon aus, dass es ein Zustand ist, der vorübergeht oder aus dem etwas Neues entsteht. Neumann berichtete in diesem Zusammenhang beispielsweise von einem Fünfjährigen, der am Morgen nach der Beerdigung seines Großvaters mit einer Schaufel vor dem Bett seiner Mutter stand und meinte, man müsse Opa jetzt schnell wieder ausgraben, sonst bekomme er ja keine Luft. In diesem Alter seien auch das Fragen nach dem Warum und das magische Denken sehr ausgeprägt, was zum einen zu fantasievollen Erklärungsversuchen für den Tod, zum anderen aber auch zu Schuldgefühlen bei Kindern führen kann, etwa indem sie sich für den Tod der Bezugsperson verantwortlich fühlen. Mit sich selbst bringen Kinder in diesem Altern den Tod meist nicht in Verbindung, sie nehmen ihn fast ausschließlich im Zusammenhang mit dem Alt-Sein oder Gewalteinflüssen wie z. B. Unfällen wahr.
Im Grundschulalter (bis etwa 10 Jahre) entwickelt sich das Verständnis des Kindes weiter und die Endgültigkeit des Todes wird immer bewusster. Gleichzeitig fällt es den Kindern in der Regel schwer, die eigenen Gefühle und Bedürfnisse einordnen und ausdrücken zu können. Hier können und sollten Eltern, nahe Bezugspersonen oder auch Helfer von außen unterstützend eingreifen.
Bei Jugendlichen sind die Vorstellungen von Tod und Sterben ähnlich denen der Erwachsenen. Sie beziehen die Thematik auch auf sich selbst und hoffen beispielsweise, bei ihrem eigenen Tod keine Schmerzen zu haben. Gleichzeitig gewinnen für sie ganz alltagspraktische Fragen an Relevanz und sie machen sich etwa Sorgen, wie es nach dem Tod eines Elternteils finanziell weitergehen soll oder wie sich das Familienleben verändern wird. Häufig übernehmen sie mehr Verantwortung in der Familie und Aufgaben oder auch Rollen, die bisher der Verstorbene innehatte. Bis zu einem gewissen Grad sei das normal und völlig in Ordnung, so Neumann. Dennoch sollte dieser Prozess aufmerksam beobachtet werden und auch wenn die weitere Entwicklung des Jugendlichen in jedem Fall beeinflusst werden wird durch den Tod einer nahestehenden Person und das veränderte Sozialgefüge sowie mögliche neue Verantwortungen, gelte es doch, dem Heranwachsenden immer noch das Leben eines normalen Jugendlichen zu ermöglichen. Dazu kommt als Herausforderung in dieser Altersphase die grundsätzliche Unsicherheit im Blick auf die eigenen Gefühle.Oft, aber nicht nur, betrifft die Notwendigkeit von AKI Menschen, die dauerhaft beatmet werden müssen. Ursachen können Behinderungen unterschiedlichster Art oder fortschreitende Erkrankungen sein. Allen gemeinsam ist die ständige Angewiesenheit auf eine Pflegeperson sowie eine technische Abhängigkeit etwa von einem Beatmungsgerät und/oder einem Monitor. Das bedeutet im konkreten Alltag für die Betroffenen neben der ohnehin gegebenen immensen körperlichen Einschränkung auch zusätzliche psychosoziale Belastungen. Jeder Mensch braucht immer wieder Abstand, die Möglichkeit zum Rückzug und Zeit für sich alleine. Vor allem für Jugendliche kann das zu einer großen Herausforderung werden, erschwert die ständige Abhängigkeit doch den in dieser Phase üblichen Transitions- und Ablösungsprozess. Zudem spiegelt der Monitor für geübte Augen auch die emotionalen Zustände einer Person. Der Mensch wird nahezu transparent und lesbar – keiner findet das angenehm, am wenigsten vermutlich Jugendliche in der Pubertät.
Trauererleben, Trauerwege, Traueraufgaben
Wie Kinder mit der Trauer selbst umgehen, hängt wie auch die Vorstellungen über den Tod von verschiedenen Faktoren ab. Wie waren die Umstände? War es ein zu erwartender Abschied oder ein plötzlicher, dramatischer Tod? Wie geht die Familie, das Umfeld damit um? Wie wird Trauer dort gestaltet? Wie war die Beziehung zum Verstorbenen? Grundsätzlich gilt: Kinder trauern anders als Erwachsene. Hier ist deshalb Sensibilität und genaues Hinschauen und Eingehen auf das Kind nötig.
Der US-amerikanische Arzt und Trauerforscher J. William Worden formuliert vier „Traueraufgaben“. An erster Stelle steht das Akzeptieren des Verlustes als Realität. Es folgt die Verarbeitung des Schmerzes, das Anpassen an eine Welt ohne den Verstorbenen und schließlich der Schritt, eine dauerhafte, neu gestaltete Verbindung mit der verstorbenen Person zu finden.
Kinder durchlaufen diese Verarbeitungsprozesse oft auf spielerische Art und Weise, eher instinktiv, mit kindlichen Handlungen, individuellen Gefühlsäußerungen und gesunder Neugier. Sehr hilfreich dabei sei die Natur, so Neumann. Insgesamt habe aber trotz mancher Parallelen jedes Kind seinen ganz eigenen Weg zu trauern. Hier solle man darauf achten, diese unterschiedliche Formen und Intensitäten auch zuzulassen: wann und wie lange das Kind trauert, die „Trauerpausen“, die es macht, wem es seine Gefühle zeigt und wem nicht, wie es seine Trauer ausdrückt, was es neben dem Trauern noch alles macht. Manchmal seien Eltern beispielsweise besorgt, wenn das Kind gar nicht trauert. Neumann empfiehlt in diesem Fall, genau hinzuschauen, vielleicht trauere das Kind bloß anders. Jugendliche zum Beispiel trauern z. T. weniger im familiären Umfeld als im Freundeskreis. Manchmal komme es auch dazu, dass Vorlieben oder Hobbys auf einmal exzessiv ausgelebt werden. Es sei wichtig, so Neumann, dass diese Individualität, die letzten Endes auch Persönlichkeitssache sei, zu akzeptieren.
Kindliche Erfahrungen mit Abschied, Tod und Sterben
Was genau braucht nun ein trauerndes Kind? Neumann hat hier eine Fülle an hilfreichen Hinweisen. Zunächst sei es wichtig, den Kindern Aufmerksamkeit, Gemeinschaft, Stabilität, Orientierung im Tagesablauf und auch trauerfreie Zonen zu geben und ermöglichen. Hier können, vor allem wenn die verantwortlichen Erwachsenen selbst mit ihrer Trauer zu kämpfen haben, auch gut außenstehende Personen, etwa Freunde, Lehrer oder Trauerbegleiter, unterstützen. Bei Fragen gelte es, aufrichtige Antworten, Informationen, Erklärungen und Beschreibungen zu geben und keine Floskeln wie etwa „Alles wird wieder gut“, denn diese stimmten oft einfach nicht. „Ich habe durch die Kinderhospizarbeit gelernt, sehr auf meine Worte zu achten“, meint Neumann. Sachliche Erklärungen und ehrliche Antworten, vor allem im Schul- und Jugendalter, beugen zudem der Möglichkeit vor, dass das Kind eigene, fantastische, u. U. viel schlimmere Theorien etwa zu einer Krankheit entwickelt. Auch ein offener Umgang mit den eigenen Gefühlen, ein „Vorleben der Trauer“ sei unterstützend. Diese authentische Kommunikation eigener Emotionen könne man schon im Alltag bei ganz kleinen Dingen, schönen wie schweren, üben. Hilfreich seien oft auch kreative Angebote. Manchmal nutzen die Kinder in ihrer Trauerbegleitung vorgegebene Ideen und Materialien, manchmal bringen sie auch eigene Vorschläge ein, berichtet Neumann aus ihrer Arbeit. So könne etwa ein Brief mit in den Sarg gelegt oder dieser bemalt werden, eine Kerze gestaltet oder überlegt werden, welches Kleid man zur Beerdigung tragen möchte. Gemeinsam könne man beispielsweise auch Erinnerungsstücke sichern, d. h. die Kinder beispielsweise etwas aus der Wohnung des Verstorbenen aussuchen lassen. Im Letzten gehe es dabei vor allem darum, den Kindern Raum und Zeit zu geben, ihre Trauer zu verarbeiten. Auch Rituale seien sehr hilfreich.
Grundsätzlich sei es zentral, den Kindern Liebe und Zuneigung zu geben und sie mit ihren Gefühlen, welche auch immer das sind, anzunehmen und auszuhalten. Kinder seien keine kleinen Erwachsenen und reagierten daher auch anders als Erwachsene, so Neumann. Auch das Bedürfnis nach Abstand sollte respektiert werden, v. a. Jugendliche müssen sich und ihre Gefühle oft erst in Ruhe sortieren und sich klar darüber werden, was sie wollen und brauchen. Im Blick auf das allgemeine Umfeld ist es meist besser, erst einmal nicht zu viele Veränderungen vorzunehmen und diese, falls sie dennoch nötig sein sollten, möglichst mit dem Kind zu besprechen. Auch sollte darauf geachtet werden, eine gewisse Normalität aufrechtzuerhalten und neben der Trauer auch andere Probleme wahr- und ernst zu nehmen. Auch das soziale Umfeld, beispielsweise die Schule, sollte beachtet und die Kinder mit ihren dortigen Herausforderungen nicht alleingelassen werden. Manchmal kommt es dazu, dass Kinder leichter angegriffen, ausgegrenzt oder gemobbt werden, wenn sie durch einen Verlust verletzlicher geworden sind.
Sie lieben, ernst nehmen, sie ermutigen und auf ihre Fragen und Gefühle eingehen – wenn man es schaffe, so den Kindern zu helfen, erleichtere es die Situation meist für die ganze Familie. Das aktive Tun mindert dabei auch das eigene Gefühl der Hilflosigkeit und zudem liegt in den kindlichen Bewältigungs- und Ausdrucksformen viel, was es sich auch als Erwachsener (wieder) zu lernen lohnt.
Mit Kindern über Tod und Sterben sprechen
Wenn es darum geht, Tod und Sterben, den Verlust eines Menschen oder die Trauer explizit mit Kindern zu thematisieren, empfiehlt Neumann vor allem eine Haltung sensibler Offenheit und Präsenz. Es sollte Gesprächsbereitschaft signalisiert werden, ohne zu drängen. Man müsse sich Zeit nehmen und dem Kind auch Zeit geben, Pausen aushalten, vielleicht auf einen passenden Moment warten oder, wenn eine Frage in einem Moment gestellt wird, in dem man gerade nicht in Ruhe antworten kann, dem Kind zusagen, dass man sich um sein Anliegen kümmern wird und dies auch zeitnah einhalten. Dabei darf man sich immer wieder bewusst machen, dass man nicht jede Frage beantworten können muss, sondern auch ehrlich sagen darf, wenn man etwas nicht weiß oder selbst Fragen hat. Auch ein offener Umgang mit den eigenen Gefühlen sei hilfreich. Manchmal biete es sich auch an, eine Rückfrage zu stellen und beispielsweise auf die Frage nach einem Leben nach dem Tod mit „Was denkst du denn darüber?“ zu reagieren. Dies ist in der Trauerbegleitung vor allem bei Kindern sinnvoll, deren Hintergrund man noch nicht gut kennt. Insgesamt können auch unabhängig von einem direkten Verlust im nahen Umfeld immer wieder Alltagssituationen (eine Nachricht im Radio, ein Vogel, der gegen die Scheibe fliegt und stirbt, …) genutzt werden, um möglichst unbelastet über das Thema Tod und Sterben ins Gespräch zu kommen.
Erinnerungen und Rituale
In einem letzten Punkt verwies Neumann schließlich auf die Bedeutung von Erinnerungen und Ritualen. Besonders herausfordernd sei meist das erste Jahr nach einem Todesfall, da der ganze Rhythmus der Monate, Jahreszeiten und Feste zum ersten Mal ohne den Verstorbenen stattfinden. Hier sollte bewusst darauf geachtet werden, wie die unterschiedlichen Zeiten und Höhepunkte des Jahres gemeinsam vorbereitet und neu gestaltet werden können. Ganz wichtig sei es zudem, Erinnerungen zu pflegen, zu bewahren, zu sammeln, vielleicht sogar zu wecken, um dem Verstorbenen einen neuen, dauerhaften Platz zu geben. Dazu können beispielsweise Bilder, Filme, Gegenstände und Erzählungen genutzt werden. Bei all dem gelte es die Kinder möglichst zu beteiligen, um ihnen durch konkretes Tun nicht nur Ohnmachtsgefühle zu nehmen, sondern auch, um ihren Gefühlen einen Platz zu geben.
Die Kinder ernst nehmen und ehrlich sein – das sei das Wichtigste. Eigentlich, ermutigte Marion Neumann am Ende des Abends, brauche es gar nicht so viel, um trauernde Kinder zu unterstützen.