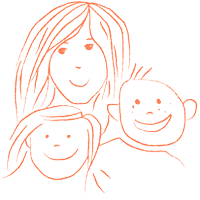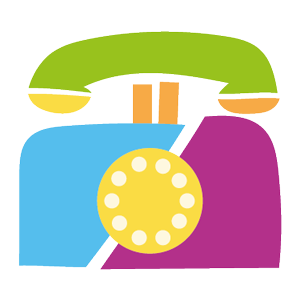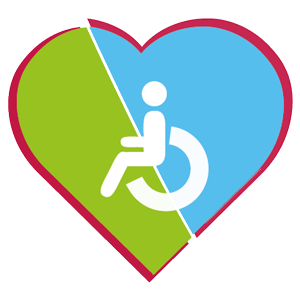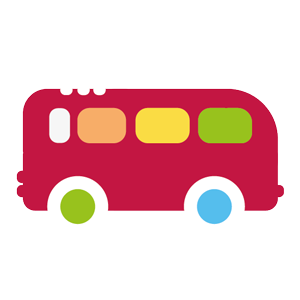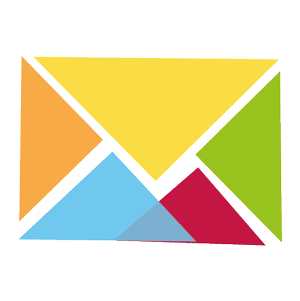Liebe Leser,
sich eine Auszeit zu nehmen, eine kleine Pause vom Alltag, ist eine schöne und wohltuende Tat. Aber was macht man mit einer Auszeit, die gar keine Auszeit ist?
Ich nehme mir eine Auszeit. Eine bewusst gewählte Auszeit. Um einfach mal wieder zu mir zu finden. Wer bin ich überhaupt? Die Seele baumeln lassen. Wieder Kraft tanken. Ein schöner Gedanke. Eine schöne Idee. Aber was macht man, wenn man sich bewusst gar keine Auszeit nehmen kann?
Ich bin müde. Kaputt. Zerschlagen. Erschöpft. Kraftlos. Meinen Alltag aufrecht zu erhalten, kostet mich unendlich viel Kraft. Jeden Tag neu zu planen und gegebenenfalls zu improvisieren. Zu reagieren. Koordinieren. Jeder Tag ist ein gefühlter Ausnahmezustand. Ich setzte mich auf die Couch um kurz innezuhalten und es fängt an. Mein Gedankenkarussell setzt sich in Gang und fährt Runde um Runde. Egal ob ich bezahlt habe oder eigentlich gar nicht mitfahren möchte. Ich schaffe es nicht auszusteigen und stehe auf. Unterbreche den Kreislauf und versuche mich bewusst mit praktischen Aufgaben abzulenken. Bloß nicht zur Ruhe zu kommen. Bloß nicht innehalten.
„Mach eine Pause.“
„Nimm Dir eine kurze Auszeit. Geh in die Sauna oder lies ein gutes Buch.“
Eine nette Idee. Gut gemeinte Tipps und Ratschläge. Aber was macht man, wenn ein Tag in der Sauna nicht mehr reicht, um sein Fass aufzufüllen? Was macht man, wenn man es noch nicht mal schafft die erste Seite eines guten Buches zu lesen, da die Gedanken immer wieder abschweifen? Was macht man, wenn an manchen Tagen sogar der Weg zum Briefkasten zu lang erscheint? Zu schwer. Die Angst vor neuen Anforderungen und Aufgaben einfach zu groß ist. Tage, an denen sogar das Duschen zu viel ist. Zu anstrengend ist. Zu lästig erscheint. Tage, an denen „nur mal eben“ das Abendessen besorgen und vorbereiten schlichtweg zu viel ist. Eine Nummer zu groß ist.
An diesen Tagen bin ich äußerst neidisch und extrem ungerecht. Menschen, die weniger Stress zu haben scheinen, wecken Gefühle in mir, die ich nie zu haben geglaubt hätte. Gefühle, für die ich mich schäme.
Ich fange an Verabredungen abzusagen. Ausreden zu suchen. Mich zu isolieren. Ignoriere meine E-Mails und Whats App Nachrichten. Ich lasse das Telefon unbeantwortet klingeln. Ich bin empfindlich geworden. Schnell eingeschnappt. Mit den Gedanken woanders. Vieles ist mir zu kompliziert geworden und ich bleibe lieber alleine. Von außen mag ich sonderlich wirken. Zickig. Kalt und distanziert. Vielleicht auch teilnahmslos. Manchmal auch zerstreut. Durcheinander.
„Wo hat sie bloß ihren Kopf gelassen?“
Ich versuche zu lächeln. Gebe mich interessiert und äußerst freundlich. Oftmals wird mir dieses Lächeln abgekauft. Aber an manchen Tagen funktioniert noch nicht mal das und ich bleibe lieber alleine. Ein Miteinander von mir, meinem behinderten Kind und dem Rest der Gesellschaft – manche mögen es Inklusion nennen – scheint an diesen Tagen ihre Grenze zu haben, die auch ich nicht zu überwinden vermag. Die Diskrepanz zwischen meinen und anderen Bedürfnissen scheint einfach zu groß, zu unterschiedlich, zu sein.
Ich bekomme Besuch. In letzter Zeit klopft vermehrt die Angst an meine Tür. Nein, sie klopft nicht nur, sie hämmert. Die Angst und Sorge treten ein. Es scheint, umso stärker ich versuche, sie zu ignorieren, umso gemütlicher machen sie es sich bei mir. Am Abend ist es besonders schlimm. Dann sitzen sie gefühlt auf meinen Schoß. Ich schlafe seit Wochen nicht mehr richtig und lasse mich von mehr oder weniger interessanten Geschichten in den Schlaf tragen.
Ich habe das Gefühl gegen einen Gegner zu kämpfen, der mir bei weitem überlegen ist. Der Ausgang des Kampfes schon vor dem Anfang offensichtlich ist. Trotzdem steige ich in den Ring. Die Zuschauer amüsieren sich. Das Stadion ist voll und mein Kampf ist gut besucht. Alle Zuschauen scheinen auf der gleichen Seite zu sitzen, scheinen dasselbe Leben zu führen nur ich bin irgendwie mitten drin aber nicht dabei. Und Evan? Mein kleiner Michel hüpft mal dort herum und hier herum. Immer mit einem Lächeln im Gesicht. Er scheint meine Diskrepanz nicht zu spüren. Dieses Mal ist es MEIN und nicht unser Kampf. Evan geht es gut und das freut mich aus tiefstem Herzen. Evan braucht keine theoretische Inklusion, da er sich in jeder Runde und Begebenheit selbst inkludiert. Egal ob es erwünscht ist oder nicht. Das ist ihm schlichtweg scheißegal. Evan ist immer dabei. Es scheint wunderlich, dass sich die Nicht-Behinderte in unserer Familie mehr Inklusion wünscht als der eigentlich Betroffene.
Ich möchte schöne und fröhliche Bilder posten mit schönen und fröhlichen Unterschriften. Ich möchte einen Artikel schreiben wie unbeschwert unsere letzte Urlaubsreise nach Italien war und wie gut erholt ich zurückgekehrt bin. Wie aufgefüllt mein Fass ist und wie sehr ich vor Kraft strotze. Schreiben, dass ich etliche Latte Macchiatos in der Sonne genossen habe. Schreiben, dass ich alles schaffe und es mir hervorragend, ja blendend geht. Dass nach dem Regen direkt die Sonne scheint und man immer das Licht am Ende des Tunnels sieht. Aber das wäre in meiner jetzigen Phase nicht wirklich ehrlich sondern schlicht gelogen.
Nach dem Regen scheint die Sonne. Den Ausspruch, den ich vor ein paar Zeilen noch dementiert habe, scheint in meiner jetzigen Phase in abgeänderter Form zuzutreffen. Die Sonne scheint im Regen. Das mag kitschig klingeln oder nach einem gewollten, erzwungenen, Happy End. Ganz nach dem Motto: Ende gut alles gut. Nein. Kein gewolltes oder erzwungenes Happy End eher ein tiefes Gefühl seit Langem mehr bei mir zu sein. Meine Gefühle, egal ob positiv oder negativ, ernst zu nehmen. Sie nicht einfach mehr nur zu ignorieren und zu funktionieren.
Ich nehme mir seit sehr langer Zeit das Recht heraus, nicht zu telefonieren oder E-Mails zu beantworten. Ich versuche nicht zu lächeln, wenn mir nicht danach ist. Die Frage „Wie geht es Dir?“ ehrlich zu beantworten. Egal ob es erwünscht ist oder nicht. Wenn ich es nicht schaffe, noch schnell einen Kuchen für den Geburtstag meiner Freundin zu backen, dann sage ich es direkt oder indirekt (ich gehe einfach nicht ans Telefon). Wenn mir ein Treffen mit Freunden zu kompliziert oder umständlich erscheint, dann spreche ich es aus. Auch mit der Gefahr „die Komische“ zu sein. Diejenige zu sein, die immer eine Extrawurst braucht.
Ich bin angekommen. Angekommen an einem Wendepunkt. Das spüre ich ganz deutlich. Jede Phase meines Körpers zeigt es mir ganz klar. Es zu ignorieren bringt nichts, da mein Körper rebelliert. Meine innerliche Armee ist aufmarschiert und wird sich dieses Mal nicht einfach wieder zurückziehen oder sich mit einem Saunabesuch zufrieden geben. Einen Kampf gegen meinen Körper und meine Gefühle zu führen, ist sinnlos. Und ganz ehrlich, das möchte ich auch nicht. Das habe ich lange genug getan. Mein Körper und meine Gefühle geben Acht auf mich. Sie sind nicht, wie lange Zeit angenommen, mein Feind sondern ein liebevoller Freund. Ein Freund, der es ehrlich mit mir meint.
Ich mag das Licht am Ende des Tunnels – noch – nicht sehen aber ich gehe weiter geradeaus. Davon gehe ich zumindest stark aus. Im Dunkeln ist es bekanntlich nicht immer einfach, herauszufinden in welche Richtung man läuft.
Es stehen Veränderungen an. Kleine und große. Einfache und schwierige. Egal wie aufwühlend diese Zeit auch sein mag, irgendwie macht mir diese Veränderung Mut und gibt mir Kraft. Ich fühle mich befreit und erleichtert. Befreit von eigenen sozialen Zwängen und Vorstellungen und erleichtert von schwerem Gepäck. Ballast.
Liebe Leser, ich hätte mir gewünscht diesen Artikel in der Vergangenheitsform zu schreiben und mit dem Satz „Ende gut alles gut“ aufzuhören. Stattdessen befinde ich mich in der Gegenwart, mittendrin in meinem Prozess, dessen Ausgang ich noch nicht genau benennen kann. Aber ich bin mir sicher, irgendwann komme ich irgendwo an. Und dort wird dann auch die Sonne scheinen.
Herzlichst
Marcella
Die Kolumne „Anders und doch normal“ von Marcella Becker erscheint monatlich und beschäftigt sich mit Themen, die die meisten wenn nicht gar alle Eltern behinderter Kinder kennen.
Marcella wohnt mit ihrem Sohn Evan (5) in der Nähe von Bremen. Evan hat das hypoplastische Linksherzsyndrom (HLHS) und lebt in seiner eigenen, besonderen Welt, denn Evan ist Autist.
Illustration: Eva-Maria Unglaube
Es gibt viele individuelle Wohnmöglichkeiten, um möglichst selbstbestimmt zu leben und dabei nicht auf die…
Stationäre Pflege umfasst die vollstationäre Pflege, die teilstationäre Pflege (Tages- und Nachtpflege) und die Kurzzeitpflege.…
Die ambulante Pflege, auch häusliche Krankenpflege genannt, ist das Gegenteil der stationären Pflege. Qualifizierte Pflegekräfte…
Wird für schwerstbehinderte Menschen mit sehr hohem Hilfs- und Pflegebedarf ein Leben im Heim erwogen,…
Suche nach Wohn- und Pflegeeinrichtungen für junge Menschen muss klug angegangen werden Seniorenheime gibt es…
Es gibt bereits viele Beispiele für gut funktionierende inklusive WGs in Deutschland, allerdings bisher nur…
Wenn Du barrierefrei bauen oder Deine Wohnung, Dein Haus umbauen möchtest, solltest Du Dich mit…
Das Sozialgesetzbuch sieht verschiedene finanzielle Hilfen vor, wenn es darum geht, das Wohnumfeld barrierefrei zu…
Ein Pflegefall tritt meist unerwartet ein. Auf die Situation, plötzlich ein Kind pflegen zu müssen,…
In der Behindertenhilfe gibt es Reformprozesse: Es geht darum, behinderten Menschen ein selbstbestimmtes Leben und Teilhabe an…
Für viele Eltern ist der Umzug des eigenen Kindes in eine vollstationäre Einrichtung noch immer…
Es gibt nur wenig aussagekräftige Daten über Menschen mit Schwerstbehinderung und hohem Hilfs- und Pflegebedarf.…
Die Pflege eines schwerbehinderten Menschen zu Hause kostet Kraft. Das hat der Gesetzgeber erkannt und…
Alltagsbegleiter können eine große Hilfe für pflegende Angehörige sein, indem sie z.B. Aufgaben im Haushalt…
Bei längerer Krankheit oder Pflegebedürftigkeit treten häufig viele Fragen auf. Welche Leistungen stehen mir zu? Und wo kann…
Kennt ihr das, das schöne, mulmige Gefühl bei der ersten Abfahrt in der Achterbahn? Genau…
Bei der diesjährigen DreamNight im Frankfurter Zoo, einem besonderen Event für Familien mit behinderten oder…
Der Benefizlauf in Königstein war für unsere Familien ein Ereignis voller strahlender Momente und bewegender…
Unser Väter-Geschwistertag konnten wir dank der großzügigen Spende und des ehrenamtlichen Engagements der Mitarbeiter von…
Heute hätte Philip Julius seinen 30. Geburtstag gefeiert. Anlässlich dieses besonderen Ereignisses hat sein Papa…
Manche Tage bleiben uns im Gedächtnis - andere versinken im Nebel. Für Familien mit schwerstbehinderten Kindern…
Die Geschwisterkinder hatten das Vergnügen, einen kreativen Nachmittag im Kunstverein Bad Vilbel zu verbringen. Unter…
Im September feierte unserer Philip Julius e.V. sein 10-jähriges Jubiläum mit einem besonderen Galaabend, der…
Im letzten Monat hatten Kenan Terzi und seine Familie gemeinsam mit unserem Schirmherrn Jens Hajek…
Die medizinische Leiterin, Mechthild Pies, machte mit der Vorstellung des Medizinischen Zentrum für Erwachsene mit…
Ein Jahr voller Abenteuer Bei unseren Geschwistertreffen in Bad Vilbel haben wir in diesem Jahr…
Geschrieben von Annalia Machuy, Dezember 2023 Acht Familien konnte „Philip Julius e. V.“ in diesem Jahr…
Ein Erfahrungsbericht von Marian Grau Inmitten der dichten Nadelwälder des Schwarzwaldes, am Hang eines kleinen…
Chrismon, das evangelische Magazin veröffentlichte im Oktober einen Text von unserem Vorstand Jörg Eigendorf. Darin…
Philip Julius konnte nicht sehen, nicht sprechen, nicht einmal den kleinen Finger heben – nur…